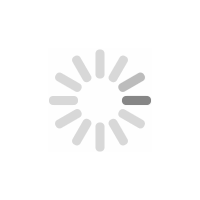Blog Beiträge
Europäisches Parlament verabschiedet CS3D: Neue ESG-Litigationrisiken in der Lieferkette
24. April 2024
Unternehmen haften künftig auch zivilrechtlich nach europäischen Vorgaben für Menschenrechts- und Umweltverletzungen entlang globaler Lieferketten. Am 24. April 2024 hat das...